
Fallstudie zur Verbesserung der Fertigungseffizienz
Diese Fallstudie zeigt, wie ein mittelständisches Fertigungsunternehmen durch gezielte Maßnahmen zur Prozessoptimierung seine Produktionseffizienz nachhaltig steigern konnte. Im Fokus stehen Herausforderungen im Fertigungsalltag, die Entwicklung individueller Lösungen gemeinsam mit Fachleuten sowie die Implementierung und die Resultate dieser Optimierungen. Die Case Study beschreibt transparent, wie der Weg zu einer effizienteren Fertigung ablief und welche Erkenntnisse für ähnliche Unternehmen hilfreich sein können.
Ausgangssituation und Herausforderungen

Ineffiziente Prozesslandschaft als Hemmnis
Die Fertigungsprozesse im Unternehmen waren historisch gewachsen und dadurch komplex sowie schwer überblickbar. Viele Arbeitsschritte waren nicht optimal miteinander verknüpft, wodurch Materialflüsse stockten und wertvolle Produktionszeit verloren ging. Maschinen standen regelmäßig still, weil Vorprodukte fehlten oder Bediener auf Freigaben oder Informationen warteten. Diese Ineffizienz war ein zentrales Hemmnis für den Unternehmenserfolg und führte dazu, dass Aufträge oft nur mit erhöhtem Zeit- und Personalaufwand erfüllbar waren. Daher war es notwendig, Transparenz über die Abläufe zu schaffen und die größten Engpässe zu identifizieren.

Schwankende Produktivität und Qualitätsprobleme
Die Produktivität schwankte stark, was vor allem auf wechselnde Auslastung und häufige Wechsel im Personal zurückzuführen war. Insbesondere bei Spitzenaufträgen waren Ausfälle und Nacharbeit an der Tagesordnung. Diese Qualitätsprobleme belasteten nicht nur Kundenbeziehungen, sondern führten zudem zu Mehrkosten durch Nacharbeit und Ausschuss. Das Qualitätsmanagement war vor Optimierungsbeginn stark reaktiv geprägt und nicht in der Lage, systematisch Prävention zu betreiben. Die Einleitung von Verbesserungsprozessen war daher unvermeidlich.
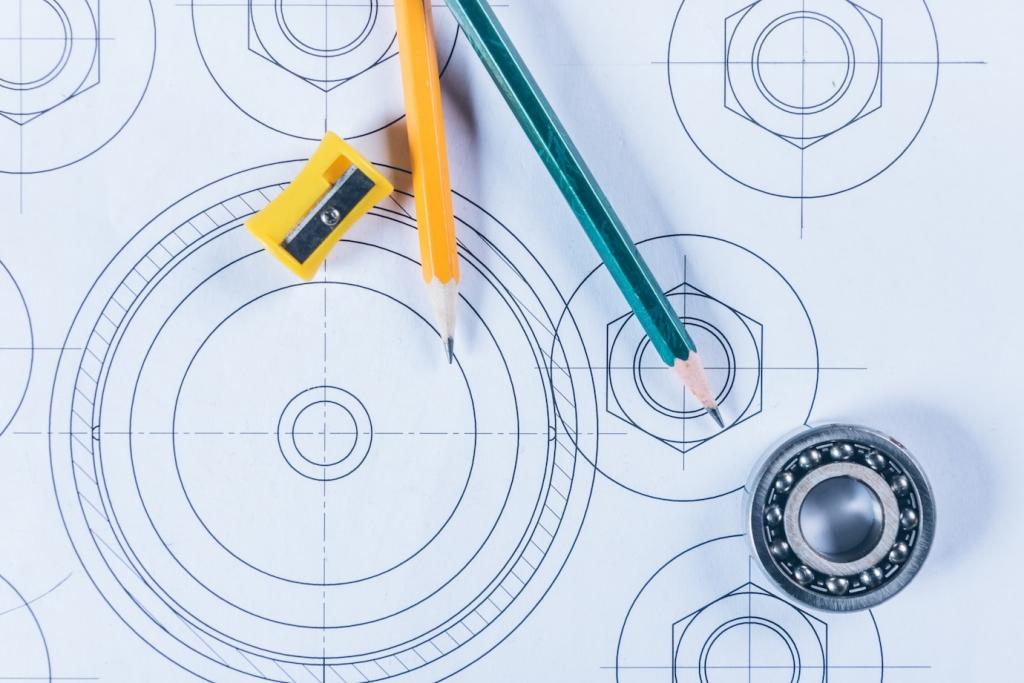
Kosten- und Wettbewerbsdruck gestiegen
Der Markt, in dem das Unternehmen agiert, ist durch internationalen Wettbewerb geprägt. Kunden fordern nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern erwarten auch kurze Lieferzeiten und attraktive Preise. Wettbewerber aus dem Ausland konnten durch ihre schlankeren Fertigungsstrukturen zum Teil günstigere Angebote unterbreiten. Deshalb musste das Unternehmen handeln, um sich langfristig am Markt zu behaupten. Der steigende Kosten- und Wettbewerbsdruck wurde als Anlass genommen, ein umfassendes Effizienzsteigerungsprojekt zu starten.
Analysephase und Lösungsentwicklung
Erhebung und Auswertung von Kennzahlen
Ein wichtiger erster Schritt war die Erfassung betrieblicher Kennzahlen entlang der gesamten Fertigungskette. Beispielsweise wurde die OEE (Overall Equipment Effectiveness) für Maschinen nicht nur gemessen, sondern auch regelhaft ausgewertet. Auch Durchlaufzeiten, Rüstzeiten und Ausschussquoten wurden lückenlos dokumentiert. Die so gewonnenen Daten gaben umfassenden Aufschluss über Schwachstellen und zeigten, welche Prozessabschnitte zu unnötigen Verzögerungen führten. Durch diese datengetriebene Analyse konnten gezielt die Bereiche identifiziert werden, in denen am dringendsten Optimierungsbedarf bestand.
Identifizierung von Potenzialen im Materialfluss
Die Analyse brachte ans Licht, dass besonders beim innerbetrieblichen Materialtransport hohe Verlustzeiten entstanden. Transportwege waren unstrukturiert, Doppelwege und unnötige Pufferbestände sorgten für Verzögerungen. Mithilfe von Wertstromanalysen und Gesprächen mit Mitarbeitern aus Produktion und Logistik wurden die Ursachen erfasst. Es wurde deutlich, dass gezielte Verbesserungen im Materialfluss einen merklichen Einfluss auf die gesamte Fertigungseffizienz haben würden. Daraufhin entstand der Plan für ein umfassendes Layout- und Logistikkonzept.
Entwicklung individueller Lösungskonzepte
In Abstimmung mit den Fachabteilungen wurden maßgeschneiderte Maßnahmen erarbeitet, um die identifizierten Schwachstellen zu beseitigen. Neben technischen Verbesserungen wie dem Einsatz moderner Fördertechnik spielte die Digitalisierung der Abläufe eine bedeutende Rolle. Schulungskonzepte für die Belegschaft wurden entwickelt, um die Akzeptanz und Kompetenz im Umgang mit neuen Technologien zu fördern. Ziel war es, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren, der über die ersten Optimierungsschritte hinaus dauerhaft zu Effizienzsteigerungen führt.
Implementierung der Optimierungsmaßnahmen
Einführung neuer Fertigungstechnologien
Ein zentrales Ergebnis der Analyse war der Bedarf an modernen Fertigungstechnologien, insbesondere im Bereich der Automatisierung. Daher investierte das Unternehmen in automatisierte Transport- und Lagerlösungen sowie moderne Steuerungssysteme für die Maschinen. Diese Technologien ermöglichten eine bessere Auslastung der Anlagen und reduzierten Stillstandszeiten deutlich. Die Einführung wurde von intensivem Training begleitet, sodass die Mitarbeiter die Systeme schnell und sicher bedienen konnten. Trotz anfänglicher Skepsis erwiesen sich die technologischen Neuerungen als entscheidender Hebel zur Erhöhung der Fertigungseffizienz.
Optimierung des Shopfloor-Managements
Parallel zur technologischen Erneuerung wurde das Shopfloor-Management neu organisiert. Es wurden klar definierte Verantwortlichkeiten eingeführt und tägliche Abstimmungsroutinen etabliert, damit Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden konnten. Visualisierung von Kennzahlen und Statusanzeigen auf dem Shopfloor halfen dabei, die Transparenz zu erhöhen und die Kommunikation zwischen den Teams zu verbessern. Durch diese Maßnahmen sanken nicht nur die Durchlaufzeiten, sondern auch die Fehlerquoten in der Produktion. Die kontinuierliche Überwachung der Prozesse trug wesentlich zur Stabilisierung und Verbesserung der Fertigungsleistung bei.
Förderung der Mitarbeiterkompetenz
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Maßnahmen war die gezielte Einbindung und Qualifizierung der Mitarbeiter. Neben den technischen Schulungen wurde auch ein Programm zur Förderung der Eigenverantwortung und Problemlösungskompetenz ins Leben gerufen. Teams wurden ermutigt, eigene Verbesserungsvorschläge einzubringen, die dann gemeinsam umgesetzt wurden. Die Kultur der Offenheit und Zusammenarbeit sorgte dafür, dass Veränderungen schnell akzeptiert und dauerhaft verankert werden konnten. Die Belegschaft entwickelte ein neues Verständnis für Effizienz und Qualitätsbewusstsein, das sich positiv auf die gesamte Produktion auswirkte.
